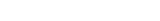Third Place: Die Stadt wird zum Wohnzimmer
Im Zeichen der gewachsenen Mobilität gewinnen Third Places an Bedeutung. Die Menschen verbringen mehr Zeit in Transitzonen – und draussen in den Quartieren. Daraus entstehen neue Nutzungskonflikte.
Plötzlich stehen Stühle auf dem Quartierplatz. Versehen mit dem Logo der Stadt. Anders als die fest installierten Sitzbänke sind sie frei verschiebbar, ja, sie sind nicht einmal gesichert. Sie laden geradezu offensiv dazu ein, sich im öffentlichen Raum aufzuhalten.
Die Stadtstühle, die man in Bern oder Zürich findet, sind das vielleicht sichtbarste Symbol dafür, wie die Menschen den öffentlichen Raum immer stärker in Beschlag nehmen. Generell werden die Räume des Dazwischen, die Third Places, die weder Wohnung noch Arbeitsplatz sind, wichtiger. Das liegt unter anderem an der gestiegenen Mobilität der Menschen, aber auch daran, dass die Städte wachsen. Immer mehr Menschen drängen sich auf beschränktem Raum – und nutzen auch den öffentlichen Raum.
Das deutsche Zukunftsinstitut definiert «dritte Orte» als «Räume der Begegnung»: «Das können öffentliche Räume im Stadtraum sein, aber auch halböffentliche Orte wie Bahnhöfe, Bildungseinrichtungen, Sport- oder Kulturstätten.» Ursprünglich geht das Third-Place-Konzept auf den amerikanischen Soziologen Ray Oldenburg zurück, der so die Orte ausserhalb der klassischen Bereiche Zuhause und Arbeitsplatz bezeichnete. Gemeint waren etwa Kirchen, Cafés, Bibliotheken oder Parkanlagen. In seinem Buch «The Great Good Place» von 1989 argumentiert der Soziologe, diese dritten Orte seien wichtig für die Zivilgesellschaft und die Demokratie. Sie bilden einen Ausgleich zu den Sphären des Privaten und des Beruflichen. In diesen (halb-)öffentlichen Räumen tauschen sich die Menschen auf neutralem Boden aus, diskutieren, es entsteht ein Gemeinschaftsgefühl und eine «Öffentlichkeit». Schon bei den alten Griechen galt die Agora, der Marktplatz, als «Geburtsstätte» der Demokratie.
Transitzonen werden zentrale Orte in der Stadt
Doch heute gewinnen Third Places an Bedeutung, weil die Menschen mehr unterwegs sind. Dies hängt unter anderem mit der Digitalisierung zusammen, die ortsunabhängiges Arbeiten ermöglicht. In den Städten sind manche Cafés, ja selbst Parks, voll von Menschen, die an ihrem Laptop arbeiten. Aber nicht nur die Berufsarbeit, sondern auch ehemals private Tätigkeiten verschieben sich teilweise in den öffentlichen Raum, etwa, wenn Leute lautstark private Telefongespräche im Zug führen oder auf einem städtischen Platz picknicken, als wäre es eine Wiese im Grünen.
Als Folge der Megatrends Individualisierung und Mobilität würden laut Zukunftsinstitut «besonders die Orte des Transits eine wichtige Rolle im alltäglichen Leben einnehmen» – also Bahnhöfe und Flughäfen. Diese würden «für die Städte zu einem zentralen Punkt im Alltag. Sie entwickeln sich zu Marktplätzen, Treffpunkten und Orten des Erlebnisses.» Tatsächlich: Inzwischen gibt es kaum noch grössere Bahnhöfe in der Schweiz, die nicht über eine Shopping- und Gastronomiemeile verfügen. Aber auch andere Dienstleister drängen in die Transitzone, etwa Arztpraxen oder Wellnessanbieter. Am Flughafen Zürich entsteht zurzeit mit The Circle das grösste Hochbauprojekt der Schweiz mit einer gemischten Nutzung: von klassischen Büros über Coworking-Arbeitsplätze bis zu einem Gesundheitszentrum, Gastronomie, Detailhandel, Kunst, Kultur, Unterhaltung und einem Fitnesszenter sowie einer Kindertagesstätte. An grösseren Flughäfen im Ausland gibt es Lounges, in denen man arbeiten oder entspannen kann. Dort werden auch Rückzugsmöglichkeiten für gestresste Reisende geschaffen, beispielsweise kleine, mietbare Schlafboxen.
Die Lebensqualität ist zurück
Klassische dritte Orte sind öffentliche Plätze, Parks und Fussgängerbereiche in den Städten. Hier sind die Aktivitäten in den letzten Jahren und Jahrzehnten geradezu explodiert. Von einer «Rückeroberung der Städte» schrieb die NZZ: «Die Menschen, und mit ihnen das Leben, drängen wieder in die Städte zurück.» Nachdem die Einwohnerzahlen ab den 1960er Jahren rückläufig waren, erleben die Städte seit der Jahrtausendwende eine Renaissance. Gerade Familien, die jahrzehntelang wegen der Lärmbelastung, der verschmutzten Luft oder aufgrund mangelnder Sicherheit weggezogen sind, kehren heute zurück und geniessen die hohe Lebensqualität in den Quartieren. Von der Wiederbelebung der Stadt zeugen Phänomene wie Urban Gardening oder Guerilla Gardening, Pop-up-Stores, -Cafés oder -Bars. Die Menschen gärtnern auf ihrem Balkon, im Innenhof oder pflanzen auch mal wild an. Wo Gebäude frei werden, entsteht ein Lokal, um nach dem «Aufpoppen» bald wieder zu verschwinden.
«Lebensqualität ist für Städte ein wichtiger Faktor, um im globalen Wettbewerb um die kreativen Talente die Nase vorn zu haben.»
Lebensqualität sei für Städte ein wichtiger Faktor, um im globalen Wettbewerb um die kreativen Talente die Nase vorn zu haben, schreibt das Zukunftsinstitut. «Dafür braucht es neben attraktiven Stadtquartieren und Arbeitsbedingungen auch umfangreiche Freizeit-, Erholungs- und Bildungsangebote. Sie machen aus dem Grossstadtdschungel eine Wohnlandschaft.»
Marta Kwiatkowski Schenk, die am GDI Gottlieb Duttweiler Institute in Rüschlikon zu Themen wie Mobilität und Gesellschaft forscht, sagt: «Es gibt eine Dynamik, die Stadt aufzuwerten.» Der Leitsatz sei heute: «Die Stadt muss für die Menschen da sein und nicht umgekehrt.» Seit einigen Jahren sei im Zeichen der Mediterranisierung der Städte in manchen Quartieren eine Art Piazza-Stimmung entstanden: «Man nutzt das ‹Draussen› als erweitertes Wohnzimmer.»
«Heute wird bei der Planung von Quartieren und Siedlungen der Aussenraum und das ganze Areal stärker mitgedacht.»
Das geht oft auch mit einer Verkehrsberuhigung einher. Sie habe manchmal den Eindruck, so viel Geld, wie man in früheren Jahrzehnten in die Infrastruktur für die Automobilität investiert habe, gebe man heute aus, um Parkplätze aufzuheben und Quartiere vom Verkehr zu entlasten, sagt Kwiatkowski Schenk. Auch Architekten und Stadtplaner hätten sich neu ausgerichtet: «Heute wird bei der Planung von Quartieren und Siedlungen der Aussenraum und das ganze Areal stärker miteinbezogen.» Auch für die Alfred Müller AG hat die Gestaltung der Umgebung bei Siedlungen hohe Priorität.
Vielzahl an Veranstaltungen schafft Nutzungskonflikte
Tom Steiner, Geschäftsführer des Zentrums Öffentlicher Raum (ZORA) vom Schweizerischen Städteverband, sagt: «Generell werden öffentliche Räume immer mehr zu einem Standortfaktor – auch für Personen bei der Wohnungssuche.» Eine Stadt, die ein spannendes Umfeld zu bieten habe, sei viel attraktiver als eine ohne. Das hätten die Stadtverwaltungen erkannt. «Die Lebensqualität im öffentlichen Raum hat für die Städte einen hohen Stellenwert. Früher wollte man primär Ruhe und Ordnung. Heute wollen die Städte, dass in den Quartieren etwas stattfindet.» Dabei treffen unterschiedliche Interessen aufeinander, wie GDI-Forscherin Marta Kwiatkowski Schenk sagt: «An einem Platz können etwa Hündeler, Mamas mit Kinderwagen und Geschäftsleute aufeinandertreffen. Jeder von ihnen hat andere Erwartungen.»
«Früher wollte man primär Ruhe und Ordnung. Heute wollen die Städte, dass in den Quartieren etwas stattfindet.»
Ein Konfliktherd ergibt sich laut Tom Steiner daraus, dass immer mehr Veranstaltungen in den öffentlichen Raum drängen. Die Städte würden das sogar fördern, denn Veranstaltungen beleben die Quartiere und würden von der Bevölkerung begrüsst. «Hier fragt es sich, wo ist die Grenze? Wann ist der öffentliche Raum übernutzt?» Als Beispiel nennt Tom Steiner die Kaserne in Basel, die mittlerweile von so vielen Veranstaltungen belegt ist, dass die Quartierbevölkerung unzufrieden ist, weil sie ihren Platz zu wenig nutzen kann.
In Zürich gab es grosse Diskussionen um den Sechseläutenplatz. Der repräsentative Platz an schönster Seelage war den einen zu häufig mit Anlässen belegt. Doch bei der Volksabstimmung sprachen sich die Zürcherinnen und Zürcher gegen einen Abbau von Veranstaltungen aus. Der Sechseläutenplatz sei generell ein Beispiel für eine gelungene Umsetzung, findet Stadtexperte Steiner. «Dieser Platz ist von der Bevölkerung wirklich angenommen worden und wird vielfältig genutzt.»
Um den Besuchern des Sechseläutenplatzes eine möglichst grosse Freiheit bei der Wahl ihres Sitzplatzes zu ermöglichen, sind die Stühle nicht fest im Boden verankert, sondern frei bewegbar.
Quelle: Stadt Zürich
Die meisten Konflikte im öffentlichen Raum entstehen zwischen den Bereichen Wohnen und Leben: Anwohner fühlen sich in ihrer Ruhe gestört – konkret geht es oft um Lärm, Littering oder auch mal Wildpinkeln. Und nicht selten stehen Jugendliche im Fokus, weshalb manchmal die Forderung erhoben wird, die Jungen von bestimmten Orten zu verbannen. Zur Lösung von Konflikten gebe es kein Patentrezept: «Man muss immer neu aushandeln, was möglich ist. Wichtig ist, die Menschen miteinzubeziehen», sagt Tom Steiner.
Partizipation ist denn auch ein zentraler Begriff in der Gestaltung der neuen Stadtwirklichkeit. Die Bewohner sollen sich – gerade angesichts der divergierenden Interessen – mit ihren Wünschen und Vorschlägen einbringen können, um Regeln zu finden.
Vorbildlich tat dies etwa die Stadt Zug. Mit dem Projekt «freiraum-zug» initiierte sie im Jahr 2012 ein Mitwirkungsverfahren, um herauszufinden, wie die öffentlichen Räume genutzt werden sollen.
Innenstädte werden vom Autoverkehr entlastet
Einer der Wünsche der Zugerinnen und Zuger war: weniger Verkehr in der Innenstadt. Das zu diesem Zweck geplante Vorhaben, eine Stadtumfahrung in Form eines Tunnels, ist allerdings gescheitert. «Nun suchen wir nach anderen Formen der Verkehrsberuhigung», sagt Regula Kaiser, Leiterin Stadtentwicklung Zug. Der schweizweite Trend ist klar: Die Innenstädte sollen – nicht zuletzt im Zeichen der Steigerung der Lebensqualität – vom Automobilverkehr entlastet werden. Beispielsweise hat sich Zürich etwa mit der Westumfahrung inklusive Üetlibergtunnel vor rund zehn Jahren von einem Teil des Durchgangsverkehrs durch die Stadt befreit. Die ehemalige Westtangente ist heute eine 30er-Zone, gesäumt von Stadtplätzen, Bars und Läden. In vielen Städten werden laufend Parkplätze abgebaut. «Beim Bau grösserer Siedlungen wird auch in Zug oft nur noch eine limitierte Anzahl Parkplätze bewilligt», sagt Regula Kaiser, die sich auch im ZORA engagiert.
Gleichzeitig nimmt aber der Pendelverkehr in den städtischen Ballungsgebieten keineswegs ab. Dabei setzen die Städte statt auf einen Ausbau des Individualverkehrs, der an seine Grenzen stösst, eher auf den öffentlichen Verkehr. Bus- und S-Bahn-Netze werden verdichtet und Tramlinien in die Agglomerationen verlängert: Beispiele dafür gibt es viele, sei es in Genf, Basel oder Zürich. Letztlich stösst aber auch der ÖV bald einmal an Grenzen. Daher müsse man «die bestehende Infrastruktur besser und intelligenter nutzen», fasst Kaiser das Credo der Raumplanerinnen zusammen. Dazu gehört auch die weitere Verdichtung nach innen. Der Bund unterstützt Programme, die Verkehr und Siedlung besser aufeinander abstimmen und so die Siedlungsentwicklung nach innen fördern, wie das Bundesamt für Raumentwicklung schreibt.