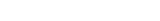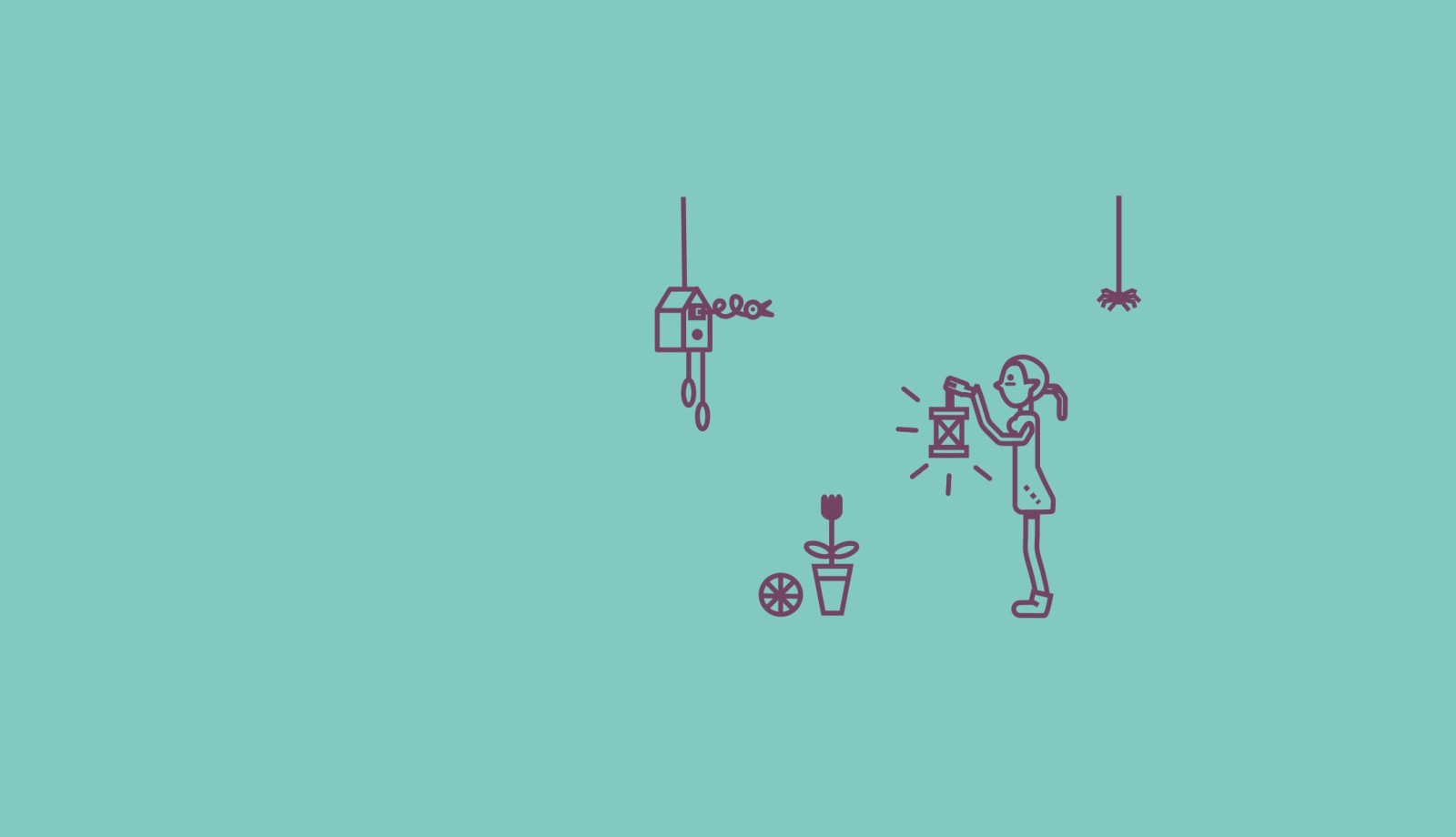
Wie viel Raum braucht das Glück?
Eine charmante und philosophische Gedankenreise der Kolumnistin Daniele Muscionico.
Gestern stiess ich mit dem Kopf gegen mein Glück. Richtig so, Glück muss man fühlen! Alles andere ist bloss Zufriedenheit. Und Zufriedenheit ist die Stiefschwester des Glücks, sie hat einen schlechten Ruf. Doch das ist eine andere Geschichte.
Vor meinem Glück also war da dieser alte Dachbalken, dazu ein Rücken, der nicht nachgiebig sein wollte, Knie, die ihren Elan mit den Jahren eingebüsst hatten – und schon war das Malheur passiert. Mein Glückszimmer hat die Stirn mit einem Mal markiert, das inzwischen in den erstaunlichsten Farben von sich reden macht. Die Frage «Wie geht es dir?» stellt man mir angesichts meines Frontschadens mit einem hämischen Grinsen.
«Mir geht es gut, ich habe Glück, schau!», sage ich und zeige stolz auf meine Stirnfassade. Dort steht es geschrieben und jeder, der kann, wird es lesen: Mein Glück lässt wenig Bewegungsraum. Denn mein grosses Glück ist ein kleiner Dachboden eines französischen Landhauses.
Wie viel Haus muss sein? Das hat sich schon der amerikanische Nationaldichter der Alternativen, Henry David Thoreau, gefragt und tätigte einen Selbstversuch von 1845 bis 1847 in einer eigenhändig gezimmerten Hütte im Wald von Massachusetts. Ob sein Teilzeitausstieg eine Leistung war? Thoreaus Mutter und Schwestern jedenfalls versorgten den Denker jeden Samstag mit Vorgekochtem.
Wie viel Haus muss sein? Wie viel Raum muss sein für einen einzelnen Menschen? Thoreau, Le Corbusier mit seiner Idee der Cabanon am Cap Martin, sie und viele andere haben sich diese Fragen gestellt. Sie lebt heute weiter in dem Tiny House Mouvement. Wer Raum sorglos zur Verfügung hat, mag die Winzlinge attraktiv finden. Wer allerdings erst um ihn kämpfen muss, der wird den Sinn von Raum nicht infrage stellen. Er kämpft, und er weiss wofür. «A Room of One’s Own» hatte die Schriftstellerin Virginia Woolf als Prämisse für ein selbstbestimmtes Frauenleben gefordert. Ihre Forderung ist noch keine 100 Jahre alt.
Meine verborgene Glückszelle ist ein Dachboden. Warum das so ist? Die Gründe liegen in der Natur der Sache. Der Dachboden ist das Zimmer, das keine Ansprüche an mich stellt. Er ist einfach da und einfach schön. Er wirft sich nicht in die Brust, sondern nimmt sich so nebensächlich wie kein anderer Raum in einem Haus. Er stellt sich zur Verfügung als ein reines, wahres, bedürfnisloses Wesen. Er ist ein Wesen mit einem selbstlosen Herz.
«Der Dachboden ist ein Raum, der nichts von mir erwartet, denn alles, was er braucht, um ein erfüllter Raum zu sein, ist bereits vorhanden.»
Ich muss den Dachboden auch nicht möblieren, eine Kunst, die mir nicht gegeben ist. Die Inneneinrichtung haben schon andere für mich erledigt, und der Lauf der Zeit war der ideale Innenarchitekt. Ich muss das Zimmer nicht erst mit intelligenten Beleuchtungskörpern ins vorteilhafteste Licht rücken. Ihm steht das Licht, das vorhanden ist. Und das ändert zu jeder Tages- und Nachtzeit.
Ich stehe im Dachboden und muss nicht grübeln, welchem Mitbewohner ich hier den Vorzug gebe, wer wann hierher einzuladen wäre und wie womit zu bewirten – seine Bewohner führen auch ohne mich ein lustiges Leben. Es scheint vor allem dann lustig, wenn ich mich in ihr Leben möglichst wenig einmische. Sie sind da, ich bin nicht allein. Aus höflicher Distanz kann ich durch die Zimmerdecke meine Mitbewohner hören. Das Getrampel und Gestöhne unsichtbarer Gesellschafter in einem französischen Dachboden ist nachts ein Chanson für sich.
Der Dachboden ist ein Raum, der nichts von mir erwartet, denn alles, was er braucht, um ein erfüllter Raum zu sein, ist bereits vorhanden. Er wird belebt von alten, ausgemusterten Träumen. Im Geruch des Holzes, des Leders, der Stoffe lebt das wahrlich Heimische. In den Spinnweben fängt sich die Zeit in Form von Insekten und Sonnenstaub. Der Dachboden ist das seltene Exemplar eines glücklichen Zimmers. Hier wohnt Glück, hier ist Glück.
Und weil es so ist, bin ich eine Enttäuschung. Ich enttäusche alle, die unser Haus loben, denn das Haus in seiner Gesamtheit soll ja das Glück der Hausbesitzer sein. Nein!
Die Raumproportionen, natürlich, sie sind oh, là, là. Das Licht, die Wärme im Winter, die Kühle im Sommer, das alles ist unbestritten de première qualité. Dazu die alten Granitmauern, verfugt von Meistern ihres Fachs, die längst ausgestorben sind. Ihre Ahnen hatten dafür gesorgt, dass Paris heute ist, was Paris werden sollte, im Kopf und auf dem Plan von Georges-Eugène Haussmann. Die Maçons de la Creuse, die Maurer der Creuse, haben einen Gutteil der modernen Pariser Boulevards, Plätze und Arkaden gebaut.
Tant pis. Dieses Haus, eine Maison de Maître, ist ein Zuhause, das von seinen Bewohnern eine Haltung einfordert. Gigantisch die Raumflächen, monströs die Raumhöhe, hier gedeiht die Grossmannssucht und wird Raum konsumiert in Massen. Die städtischen Verhältnisse haben ja zu Demut erzogen, doch in diesen anderen, ländlichen Raumverhältnissen ist Gretchen Müller sofort Madame Pompadour. Aber wofür das Viele an Luft und Licht und Launigem verwenden? Wo ist der Flatscreen, der die weite Wohnhalle möbliert? Und wo wäre ein Modell zu finden, das zu alten Granitmauern passt? Soll im Salon der Tischtennistisch platziert werden, um jenem wenigstens einen Hauch von Unordnung zu verleihen?
Viele Fragen, keine Antworten. Im Dachboden ächzt das Holz und gibt mir recht: Das Glück möbliert sich selber.