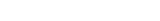Vom Luxushaus zum Wohnkoffer
Der reichste Inder lebt auf 27 Stockwerken. Hunderte Millionen von Menschen hingegen müssen mit wenigen Quadratmetern auskommen. Beim Wohnen herrschen besonders in Asien Extreme. Aber auch Zürich sorgt mit Experimenten für Aufsehen.
Sein Haus hat mehr Wohnfläche als das Schloss Versailles. Mukesh Ambani, der reichste Inder, lebt mit seiner Familie auf 37'000 Quadratmetern. Damit ist das «Einfamilienhaus» des Petrochemie-Unternehmers in Mumbai das grösste der Welt, und wohl auch das teuerste.
Hier vereinen sich Gigantismus und Luxus. Das Haus hat 27 Stockwerke und ist 173 Meter hoch. Zur Ausstattung gehören: ein Krishna-Tempel, ein Kino, hängende Gärten, drei Helikopterlandeplätze, eine Autowerkstatt, der grösste Ballsaal Indiens, eine Gesundheitsetage mit Solarium, Jacuzzi, einem Yogastudio und Fitnessräumen. Versailles sei im Vergleich mit diesem «Taj Mahal des 21. Jahrhunderts» «ein armer Cousin», schrieb die «Times of India».
Wenn der Multimilliardär Ambani auf den Balkon tritt, hat er freie Sicht auf eine komplett andere Welt, den Slum Dharavi mit seinem Wirrsal von Wellblechdächern. Hunderte von Millionen Indern wohnen in engsten Platzverhältnissen, ohne Strom, Wasseranschluss und Toilette. Nicht nur die Armen leben immer beengter. In den Megastädten Asiens wohnen die meisten Menschen auf wenig Fläche. In Tokio, mit rund 37 Millionen Einwohnern der weltgrösste Ballungsraum, hat eine Person im Schnitt 15 Quadratmeter Wohnfläche zur Verfügung. In der Schweiz ist es etwa das Dreifache!
«Die Räume in japanischen Wohnungen wurden schon immer multifunktional genutzt.»
Ein Tisch ist auch ein Stuhl
Bei der effizienten Raumnutzung ist Japan der Vorreiter. Die Baumeister haben «Ideen entwickelt, die die Zukunft anderer Länder und Megastädte vorwegnehmen», schreibt die «Frankfurter Allgemeine Zeitung». Die Grundstücke seien klein, knapp und stets teurer als die Häuser.
Millionen von Singles in Tokio leben allein auf wenigen Quadratmetern. Die Standard-1-Zimmer-Wohnung gleicht einem Schlauch, wie der «Tagesspiegel» berichtet: ein Eingangsbereich von 1 Quadratmeter mit Garderobe, eine Küchenzeile mit Stauraum, gegenüber das Bad. Geradeaus das Wohn- und Schlafzimmer. Jeder Zentimeter wird genutzt. Der Platzmangel führt zu innovativem Design. Der Architekt Keiji Ashizawa etwa arbeitet mit Schiebetüren, Stauraum in Wänden und Badezimmern, die auf engstem Platz funktionieren, da sie so konzipiert sind, dass der ganze Raum nass werden darf. Die Einrichtung ist multifunktional: Ein Stuhl ist auch ein Tisch, ein Bett auch ein Sofa.
Japanische Architekten haben einen ausgezeichneten Ruf. «Sie schaffen auf minimem Platz Komfort, bauen technisch hervorragend und entwickeln tollkühne Lösungen», sagt Köbi Gantenbein, der Chefredaktor der Architekturzeitschrift «Hochparterre». Dies habe auch damit zu tun, «dass in Japan höchstens für eine Generation gebaut wird, nicht für die Ewigkeit wie bei uns».
Ein Schlafzimmer so gross wie ein Kleiderschrank
Bauen auf parkplatzgrossen Parzellen? In Japan kein Problem. Die Mindestbreite für ein Wohnhaus beträgt 2 Meter. Auch in eine 4-Meter-Lücke wird ein Haus reingequetscht. Daher sind japanische Schlafzimmer oft so gross wie bei uns ein Kleiderschrank, die Küchen hätten in einem U-Boot Platz. Eine Spezialität aus Nippon sind auch die bekannten «Kapselhotels», wo man in Kleinstkojen schläft. Rund 4'000 Menschen in Tokio nächtigen zudem in Miniboxen in Internetcafés, da eine Mietwohnung zu teuer ist. Internetcafés haben in Japan nicht zuletzt aus dem Grund überlebt, da sie gleichzeitig Billighotels sind.
Wie der Architekt und Japan-Experte Hans Binder ausführt, kommen Japanerinnen und Japaner traditionell mit vergleichsweise wenig Wohnfläche aus – was unter anderem auch damit zu tun habe, dass Tokio schon seit mehreren Jahrhunderten eine Grossstadt sei. «Die Räume in japanischen Wohnungen wurden schon immer multifunktional genutzt», sagt Binder. Das Leben in der «Enge» sei dermassen zur Gewohnheit geworden, dass «es vielen Japanern in kleineren Räumen wohler ist als in grossen Hallen».
Abschied von der Privatsphäre
In der Schweiz sind die Flächenverhältnisse vergleichsweise luxuriös. Allerdings kann auch hier schon lange nicht mehr jeder sein Einfamilienhaus bauen. Bauland ist rar. Im Zeichen der Verdichtung entwickeln vor allem städtische Baugenossenschaften neue Wohnformen, die den sozialen Wandel reflektieren. Hier ist die Schweiz laut Gantenbein international führend.
Statt auf Familienwohnungen setzen Genossenschaften auf platzsparende Wohneinheiten für Gruppen, die sich Küche und Wohnbereich teilen. Im Genossenschafts-Hotspot Zürich gibt es solche «Cluster»-Wohnungen auf dem Hunziker Areal und in der Siedlung Kalkbreite.
Die Kalkbreite-Genossenschaft testet nun etwas Radikales: das Hallenwohnen, die «extremste aller Wohnformen». Entstanden sei diese «Wohnform der Zukunft» aus der temporären Nutzung ehemaliger Gewerberäume, so die Genossenschaft. Manche Medien verorten die Idee in der Hausbesetzerszene. Es dürfte weltweit der erste Versuch sein, eine neu gebaute Halle nach einem Gemeinschaftskonzept zu bewohnen.
Ureigene Wohnkonzepte
Vermietet wird die Halle im Rohbau an eine Gruppe – nicht an Einzelpersonen –, die «ihre ureigenen Wohnkonzepte sozial und räumlich gestalten möchte». Die Grundausstattung bilden lediglich An-schlüsse für Küche und sanitäre Anlagen. Den Innenausbau und die Raumaufteilung gestalten die Bewohnerinnen nach eigenem Gusto in Leichtbauweise. Beworben haben sich fünf Gruppen – mehr, als die Genossenschaft erwartet hatte. Der Spatenstich erfolgte im Frühjahr 2018, 2020 soll die Halle bezogen werden.
Hallenwohnen als Zukunft? Wer Wohneigentum bevorzugt, aber etwas Unkonventionelles sucht, hat Alternativen. So gibt es auch in der Schweiz neuartige Wohnmodule. Statt Gemeinschaft versprechen sie Unabhängigkeit im Mini-Eigenheim.
Leben im Minihaus
Tiny House, Ökominihaus oder Wohnkoffer: Minihäuser gibt es nicht nur in Japan, sondern auch in der Schweiz. Es handelt sich um neuartige Wohnmodule, die in der Regel verschiebbar sind. Sie sind deutlich günstiger und kleiner als konventionelle Eigenheime. Noch handelt es sich um ein Nischenphänomen.
Ein Tiny House hat oft nicht mehr als 35 Quadratmeter Fläche, ist auf einen Trailer gebaut und daher mobil. Das aus den USA stammende Konzept basiert auf der Open-Source-Idee: Viele der Besitzer bauen ihre Häuser selber und stellen die Pläne ins Internet.
Alles zum Leben auf 35 Quadratmetern
Das Ökominihaus wird primär als Wohn- und Büroraum ganzjährig genutzt, ist weitgehend energieautark und aus Holz und weiteren umweltfreundlichen Rohstoffen gebaut. Entwickelt von der Baubiologin Tanja Schindler, steht das 35-Quadratmeter-Haus für reduziertes und nachhaltiges Leben.
In kreativ gestalteten Schiffscontainern hausen Hipster in New York oder Amsterdam schon lange. In der Schweiz lebt wohl nur eine Handvoll Menschen freiwillig so. Container werden vor allem bei Zwischennutzungen oder bei Angeboten der öffentlichen Hand genutzt, etwa für Asylbewerber. Einen «Wohnkoffer» hat der Basler Architekt Pascal Müller entwickelt. Seine «Koffer» lässt er nun neu bauen. Dass kostengünstige Wohncontainer in der Schweiz kaum genutzt würden, liege wohl am hohen Wohlstand, glaubt Müller.
Häufiger finden sich Container als Schul-, Büro- oder Gewerbebauten. Der wohl berühmteste Container-Bau ist der Freitag Tower in Zürich-West. Der Flagship Store des Zürcher Design-Labels besteht aus 17 alten Frachtcontainern.