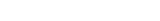Muffig? Gsellig!
Brauchen wir Bräuche? «Ja!», sagt unsere Kolumnistin und liegt damit voll im Trend.
Von einer Offenbarung zu sprechen, wäre wohl leicht übertrieben, aber ein Moment des Staunens war es, als mir Bauer Hermann «Hermi» Röllin unter einem seiner 300 blühenden Kirschbäume erzählte, wie viele verschiedene Sorten auf seinem Hof wachsen: Wölflisteiner, Zimbeler, Benjaminer, Langstieler, Buholzer, Roteschüttler, Tüfebächler, Baarburger, Dolleseppler – oder auch ganz kurz und prägnant: Kordia, Magda, Zopf und Star. Das klingt ja wie Musik in den Ohren!
Seit 600 Jahren wird die Kirsche in Zug kultiviert. Den «Zuger kriesymerckht» gibt es seit 1627 und die «Zuger Chriesigloggä», eine Art Erlaubnisglocke, die den offiziellen Start der Kirschenernte einläutet, ist seit 1711 nachweisbar. Da darf man ein wenig stolz sein. Doch bin ich – was Brauchtum anbelangt – auch wählerisch! Der Wallfahrt nach Einsiedeln leiste ich als Konfessionslose keine Folge, der Einladung des Quartiervereins zum gemeinsamen Genuss des Zuger Rötels hingegen schon. Geradezu Pflicht sind die skurrilen Einachserrennen in den Berggemeinden, wo pausbäckige Typen aufs Gaspedal treten, das Publikum sich am Benzin- und Dieselduft berauscht und die gänzlich Verrückten sich mit Dreckklumpen an den Schuhen im Motorenweitwurf messen.
Dabei stellen sich schon mal Fragen: Wie alt muss ein Brauch sein, um als solcher anerkannt zu werden? Und wann handelt es sich bei einem jährlich stattfindenden Event bloss um eine wiederkehrende Veranstaltung? Wo ist die Grenze zwischen Folklore und Kommerz? Der Tourismus hat die ökonomische Verwertbarkeit von Bräuchen längst erkannt und viele bestehende Bräuche nach kommerziellen Kriterien umgeformt und ausgebaut – mitunter bis zur Schmerzgrenze, wie mir ein Besuch des Zürcher Knabenschiessens vor vielen Jahren vor Augen führte. Einmal – und nie wieder!
Im Duden wird der Brauch mit einer «innerhalb einer Gemeinschaft festgewordenen und in bestimmten Formen ausgebildeten Gewohnheit» ziemlich grosszügig definiert. Somit schliesst er Fahnenschwingen und Alphornblasen genauso mit ein wie handwerkliche Fertigkeiten, kulinarische Spezialitäten oder – um ein weniger populäres Beispiel aus meinem Wohnort Zug zu nennen – das alljährliche Läuten der Friedensglocke am Kapuzinerturm, das jeweils am 8. Mai an das Ende des Zweiten Weltkrieges erinnert. Gerade dieses schöne, unscheinbare «Bräuchlein» zeigt, dass sich die Ernsthaftigkeit eines Brauchs nicht am Publikumsauflauf oder den Umsatzahlen, die er generiert, misst. Sonst wäre das weltweit grösste Technofestival, die seit 1992 stattfindende Zürcher Street Parade, der Brauch aller Bräuche.
Viel abgewinnen kann ich Veranstaltungen, bei denen es bodenständig und gesellig zu- und hergeht. Der Alpchäsmärcht im Muotathal, die Chestene-Chilbi in Greppen, die Jodlerchilbi in der Ruodisegg am Rigi. Vom Feinsten! Viele dieser Bräuche sind identitätsstiftend und gehorchen stark ritualisierten, mitunter starren Formen. Da marschieren am Küssnachter Klaus-jagen – Skandal! – noch immer keine Frauen mit. Ja, wo sind wir denn hier gelandet? Der Antrag eines Einheimischen an der Generalversammlung der St. Nikolausgesellschaft im Jahre 2015, am Umzug künftig auch das weibliche Geschlecht mitmarschieren zu lassen, scheiterte kläglich (20 Ja zu 720 Nein).
Viele dieser Bräuche sind identitätsstiftend und gehorchen stark ritualisierten, mitunter starren Formen.
Was soll’s? Als Zuschauerinnen sind wir willkommen, und ich bin Stammgast! Jedes Mal «schampar» aufgeregt, wenn punkt 20.15 Uhr mit dem Böllerschuss die Lichter ausgehen und die Geislechlepfer auf dem Dorfplatz es hoch konzentriert und mitunter im Gleichtakt knallen lassen, wenn dann die Iffeleträger vom Friedhof her angetänzelt kommen, gefolgt vom Dreiklang aus Trompeten und Posaunen, dann – endlich – die Klausjäger mit ihren schaurig dröhnenden Trychlen und Chlopfe vorbeiziehen und schliesslich zum Umzugsende das unablässig monotone «Tö, Tö, Tööö» der Kuhhornbläser ertönt.
«Unter den Talaren – Muff von 1000 Jahren», lautete die Parole der 68er-Bewegung. Sie verachtete Traditionen und Bräuche als Müll der Vergangenheit und wertete sie als Inbegriff einer in Konventionen erstarrten Gesellschaft. Da muss sich unsereins natürlich fragen: Bin ich zu wenig kritisch, und müsste ich traditionellen Anlässen allein aus gesellschaftspolitischen Überlegungen fernbleiben? Unsinn! Mit meiner Begeisterung für die Schweizer Volkskultur liege ich laut Pro Helvetia voll im Trend. Dort spürt man den Aufwind seit Jahren.
Zurück zum Chriesi. Seit drei Jahren helfe ich meinem Nachbarn, Bauer Albert «Bärti» Weiss, jeden Frühsommer ein paar Tage bei der Chriesi-Ernte. Was für ein Privileg, mit Wanderschuhen, kurzen Hosen und Chriesichratten um den Bauch auf die von Hand gefertigte Holzleiter zu steigen und nach den reifen Früchten zu greifen. Wie friedlich und still das Verweilen in der Baumkrone ist. Welche Aussicht sich auf dem Hochstämmer bietet. Wie erfrischend der leichte Wind zwischen den Ästen weht und angenehm schattig es dank dem üppigen Blattwerk ist. Niemand stört, kein Handy klingelt.
Selbst ein Wellness-Weekend im Luxus-Resort kann es nicht mit dem Erlebnis aufnehmen, das sich einem bei dieser so spektakulär unspektakulären Tätigkeit bietet. Und als wäre dies der frohen Botschaft nicht bereits genug, leistet man gleichzeitig einen kleinen Beitrag, um diese jahrhundertealte Tradition am Leben zu erhalten, so dass es auch in Zukunft heisst: hiesig chriesig!