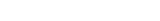Microliving – erobert die smarte Wohnform die Welt?
Im Rahmen der Studie «Microliving – Urbanes Wohnen im 21. Jahrhundert» hat das GDI Gottlieb Duttweiler Institute den Wandel des Wohnens untersucht. Stefan Breit, Co-Autor der Studie, erklärt im Gespräch mit Mélanie Ryser von Alfred Müller, welche Trends die Zukunft des Wohnens prägen werden.
Wohnen widerspiegelt den sozialen und kulturellen Zustand ganzer Gesellschaften – und passt sich sukzessive dem Menschen an. Wie könnte Wohnen in einer Welt aussehen, in der die Bewohner immer zahlreicher, urbaner, erlebnishungriger, mobiler und besitzmüder werden?
Sie haben kürzlich die Studie «Microliving – Urbanes Wohnen im 21. Jahrhundert» veröffentlicht. Worum geht es in der Studie?
Die Studie in einem Satz zusammengefasst lautet so: Zwei Trends dominieren das Wohnen der Zukunft: Individualisierung und Verdichtungsdruck. Daraus entsteht Microliving. Die Zukunft des Wohnens ist also nicht primär von technologischen Entwicklungen geprägt, sondern von gesellschaftlichen Trends.
Sie fegen über die gebaute Umwelt hinweg und haben die Macht, die Art und Weise zu beeinflussen, wie wir in Zukunft wohnen. Fast noch wichtiger als der Verdichtungsdruck ist aber auch die Tatsache, dass sich viele Bedürfnisse im Wohnen mit weniger Fläche befriedigen lassen als früher. Wir brauchen zukünftig zu Hause nicht mehr so viel Platz wie heute.
Was bedeutet Microliving konkret?
Bei Microliving geht es um maximale Vereinfachung. In der Schweiz versteht man unter Microliving Wohnungen mit einer Fläche von rund 30 Quadratmetern, die alles Notwendige zum eigenständigen Wohnen zur Verfügung stellen: eine Küche, ein Bad, ein Bett. Was Microliving global bedeutet, hängt sehr stark vom lokalen Kontext ab. In Japan kann man auf 5.8 Quadratmetern wohnen, die Ostküste der USA definiert Microliving mit 37 bis 46 Quadratmetern, anders als die Westküste mit 28 Quadratmetern. Allen Definitionen gemein ist, dass Microliving im Verhältnis zum Durchschnitt weniger Fläche anbietet. Interessanterweise ist es noch gar nicht lang her, dass ein Grossteil der Weltbevölkerung in Mcro-Apartments gelebt hat. Laut einer Studie der Vereinten Nationen verfügten 1995 weltweit nur 18 Prozent der Stadtbewohner über 20 Quadratmeter oder mehr pro Person. Jetzt kommt dieses Konzept wieder auf. Für viele ist Wohnen keine reine Prestigefrage mehr. Sie geben ihr Geld lieber für Hobbys oder Reisen aus. Somit ist Microliving eine Antwort darauf, was man beim Wohnen unbedingt braucht: einen gesicherten Platz.
«Zwei Trends dominieren das Wohnen der Zukunft: Individualisierung und Verdichtungsdruck.»
In der Studie identifizieren Sie sechs Wohntrends. Welcher wird unsere Art des Wohnens am stärksten beeinflussen?
Ich bin davon überzeugt, dass es vor allem der erste Trend ist: Collective Diversity. In diesem Trend geht es darum, dass unsere Gesellschaft, in der das Individuum immer wichtiger wird, Auswirkungen auf die Art haben wird, wie wir wohnen. Die Anzahl der 1-Personen-Haushalte steigt nach wie vor an. Wenn man immer länger und öfter allein wohnt, entsteht das Bedürfnis nach einer neuen Gemeinschaft. Dies mag paradox erscheinen, ist aber eigentlich sinnvoll. Entsprechend wird sich dieser Megatrend der Individualisierung stark auf die gebaute Umwelt auswirken.
Sie sagen, dass die Anzahl an Alleinwohnenden weiter zunimmt. Was sagt denn diese Tendenz über den Zustand unserer Gesellschaft aus?
Es ist etwas gefährlich, aufgrund der Individualisierung auf den Zustand einer Gesellschaft zu schliessen. Anhand der Art und Weise, wie eine Wohnlandschaft aussieht, lassen sich aber durchaus Rückschlüsse ziehen. Man sagt nicht umsonst, dass Wohnen der Spiegel der Gesellschaft ist. Leben beispielsweise viele Menschen auf vielen Quadratmetern, deutet das auf eine wohlstandsgesättigte Gesellschaft hin. Es beeinflusst eine Gesellschaft, wenn in gewissen Städten 50 Prozent der Haushalte 1-Personen-Haushalte sind. Man darf den Megatrend Individualisierung aber nicht mit Egoismus gleichsetzen. Die Individualisierung hat das Vertrauen ins Ich gesteigert und steht für den Wandel von Fremd- zu Selbstbestimmtheit. Alleinwohnen und Alleinsein werden immer selbstverständlicher und mit zunehmendem Selbstbewusstsein gelebt. Entsprechend zieht sich der Trend zum 1-Personen-Haushalt heutzutage durch die ganze Gesellschaft und betrifft nicht mehr nur einzelne Altersklassen.
Menschen und ihre Bedürfnisse ändern sich schneller als die gebaute Architektur. Wird Microliving dieser Veränderungsdynamik besser gerecht?
Architektur kann nur die fundamentalen Trends aufnehmen. Viele kurzfristige Strömungen prallen an den Backsteinmauern der Gebäude ab. Ich glaube aber, dass die Individualisierung und der Verdichtungsdruck tatsächlich das Potenzial haben, die gebaute Umwelt langfristig zu verändern. Der Vorteil von Microliving ist, dass diese Wohnform vom jungen Studenten bis hin zum Pensionär allen gerecht werden kann. Die Frage ist nur, wie man Microliving nutzt, wenn die Tendenz zum 1-Personen-Haushalt wieder abnimmt. Dann sind spannende architektonische Konzepte gefordert. Trends und Gegentrends funktionieren oft parallel. Wird die Welt immer individualistischer, sucht man gleichzeitig eine neue Gemeinschaft, die vielleicht nicht mehr die Familie ist, sondern aus Freunden oder Mitstudenten besteht – sozusagen eine Ersatzfamilie. Deswegen werden Wohnformen, die gleichzeitig das Individuum bedienen und die Möglichkeit für einen gemeinschaftlichen Austausch geben, in Zukunft an Wichtigkeit gewinnen.
In Ihrer Studie erwähnen Sie die Co-Living-Angebote. Ein spannendes Wohnkonzept für Startups, das aber in der Schweiz noch nicht bekannt ist. Wie funktioniert das Co-Living?
Co-Living vereint die beiden Felder Arbeiten und Wohnen. Bei solchen Angeboten versuchen Wohnkuratoren, Leute mit ähnlichen Werten und Interessen zusammenzubringen, damit sie in einen befruchtenden Austausch miteinander treten können. Das beflügelt das Bedürfnis nach einer Komfortzone im Wohnen. Für den Vermieter ist das interessant, weil die Bewohner länger bleiben, wenn sie sich in ihrem Umfeld wohlfühlen.
«Architektur kann nur die fundamentalen Trends
aufnehmen.»
Denken Sie, dass sich infolge unserer Mobilität auch die Büroflächen massiv reduzieren werden und es ein Microworking geben wird?
Ein spannender Punkt. Wohnen und Arbeiten ist räumlich für viele immer schwerer trennbar. Zahlreiche Menschen benötigen für ihre berufliche Tätigkeit nur noch Internetverbindung und Steckdose. Das ist für unsere Gesellschaft ein fundamentaler Wandel, der Auswirkungen auf unsere Art zu wohnen und zu arbeiten hat. Bereits heute stehen gewisse Büroflächen in Zürich leer, dafür wird in Cafés, im Zug, in Parks gearbeitet. Ein Büro zum Arbeiten wird vermehrt nicht mehr benötigt.
Microliving ist ein urbanes Konzept, das vor allem in grossen Städten wie Tokio, London, New York und San Francisco gelebt wird, wo Wohnraum extrem teuer ist. Wird es auch in der Schweiz ankommen?
Davon bin ich überzeugt, gerade wenn Städte noch mehr wachsen und Druck besteht, Wohnfläche zu verringern. Künftig wird Wohnen auf kleinem Raum nicht mehr per se als Verzicht wahrgenommen werden. Wohlfühlen entkoppelt sich vom Flächenverbrauch. Ob sich bei uns Konzepte wie in San Francisco durchsetzen werden, weiss ich aber nicht. Dort gibt es mittlerweile acht Projekte, die Schlafsäle, sogenannte «Dorms», anbieten. Man schläft nicht mehr in seinen eigenen vier Wänden, sondern mit 20 anderen Menschen im gleichen Zimmer. Der Hauptgrund dafür sind die sehr hohen Mietpreise.
Das Ausmass solcher Konzepte hat stark mit dem kulturellen Kontext zu tun. Auch bei uns dürften verschiedene Wohnnutzungen künftig neu kombiniert oder vermischt werden. Wenn wir nicht mehr alle Wohnfunktionen im Haus stillen, beeinflusst das die Ausstattung. Aber können wir auf eine eigene Küche verzichten? Auf ein Bad? Auf ein eigenes Schlafzimmer? Das muss jeder für sich entscheiden.
«Man sagt nicht umsonst, dass Wohnen der Spiegel der Gesellschaft ist.»
In der Studie kommt auch der Begriff «die neue Dörflichkeit» vor. Was genau ist damit gemeint?
Dieser Begriff schliesst an den Megatrend der Individualisierung und das neue Bedürfnis nach Gemeinschaft an. In gewissen Überbauungen in der Stadt versuchen die Bewohner, eine Art von Dörflichkeit zu generieren. Eine Gefahr dabei ist, dass es eine Filterblase aus Stein gibt. Man bekommt in seiner Überbauung alles, was man braucht, und setzt sich nicht mehr mit den Entwicklungen und Menschen ausserhalb auseinander. Zusammengefasst geht es um den Wandel, der es ermöglicht, auch in der Stadt eine Art Dörflichkeit zu leben.
Welches ist für Sie persönlich die einschneidendste Erkenntnis aus der Studie?
Sehr interessant zu sehen war, wie viele Leute allein wohnen. Laufen Sie mal durch Basel und klopfen Sie an eine Haustür. Die Chance, dass die Tür zu einem 1-Personen-Haushalt führt, liegt bei 50 Prozent. Landesweit übertrifft die Anzahl Alleinwohnender die gesamte Bevölkerung der acht grössten Schweizer Städte.
Geblieben ist mir auch das Beispiel des Menschenwürfels, ein spannendes Gedankenexperiment: Würde man die ganze Menschheit in einen Würfel packen, ergäbe sich ein Würfel mit einer Seitenlänge von 1.3 Kilometern. Das Gebäude wäre so klein, dass man nur eine halbe Stunde bräuchte, um einmal darum herumzujoggen. Die Erkenntnis, dass die vielen Menschen, die auf der Erde wohnen, komprimiert nur so wenig Platz in Anspruch nehmen, ist extrem eindrücklich. Dieser Würfel steht genau für die Fragen, die wir uns in Bezug auf die Zukunft des Wohnens stellen müssen: Wie nah wollen wir uns sein, mit wem wollen wir wohnen, wie können wir ein Wohnen leben, in dem wir unseren Charakter ausdrücken können? Die gesellschaftlichen Veränderungen sind dabei spannender als die technologischen. In Bezug aufs Wohnen ist es relativ egal, ob Roboter unsere Häuser bauen oder ob wir Solarpanels auf dem Dach haben. Diese Technologien tangieren das Wohnerlebnis nicht, wohl aber jene, die das Zusammenleben beeinflussen. Wenn man mit dem Smartphone ständig Familie und Freunde in der Hosentasche hat, hat das Auswirkungen auf die Art und Weise, wie wir mit unseren Nachbarn kommunizieren. Und es beeinflusst den Flächenverbrauch, den wir für unser Wohlbefinden benötigen.
Zukunft des Wohnens – Studie von iLive AG
In der Studie wurden sechs Thesen identifiziert. Sie bilden den Nährboden, aus dem sich erklären lässt, wie sich die Zukunft des Wohnens entfalten wird.
- Collective Diversity: Wohnformen differenzieren sich weiter aus, kollektive Wohnformen gewinnen an Bedeutung.
- Peak Home: Wohnfunktionen werden dekonstruiert, es kommt zu einer Co-Evolution zwischen Wohnung, Nachbarschaft und Stadt.
- Platform Living: Wohnen wird flexibler, und auch die Immobilie wird ein bisschen mobil.
- Augmented Convenience: Technologie kann Wohnen zu einem höchst personalisierten Erlebnis machen.
- Branded Living: Wohnen wird zur Marke.
- Somewhere Strikes Back: Je stärker der Trend zum mobilen, offenen Lebensstil wird, desto stärker wird auch der Gegentrend zur verwurzelten, einfachen Lebensweise.